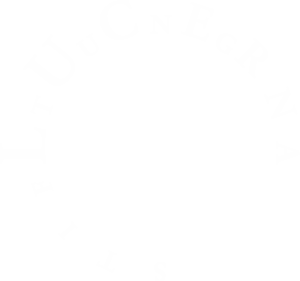Für die meisten Menschen wurden die vergangenen Monate zu einer Zeit des erzwungenen Rückzugs ins Private. Für viele von ihnen bedeutete dieser Rückzug, allein zu sein, auch wenn sie es nicht sein wollten. „Einsamkeit“ nennt man diesen Zustand. Als Abwesenheit von Freunden, Vertrauten oder Verwandten wird sie als etwas Negatives begriffen. Und als etwas Unerwünschtes, ja als ein Leiden, durchlief die Einsamkeit in den vergangenen Jahrzehnten eine große Karriere, bis hin zu ihrer Erhebung zu einer neuen „Volkskrankheit“, wie sie in der Pandemie kulminierte.

Zugleich gibt es eine andere Geschichte der Einsamkeit: als Voraussetzung für Konzentration und Kontemplation. Ohne Einsamkeit gibt es keine Selbstbefindung, kein tiefes Nachdenken und keine sorgfältige Lektüre, um von vielen kreativen Tätigkeiten nicht anzufangen. Zudem ist es zwar so, dass moderne Techniken der Kommunikation das Alleinsein erleichtern. Aber ob daraus notwendig mehr Einsamkeit entsteht, ist alles andere als gewiss.

In drei Vortrags- und Gesprächsrunden, veranstaltet von der Stiftung Lucerna und über digitale Medien übertragen, soll der Mehrdeutigkeit des Begriffs „Einsamkeit“ nachgegangen werden, mit dem Ziel, mehr Klarheit über ein gegenwärtig weitverbreitetes Gefühl zu schaffen.